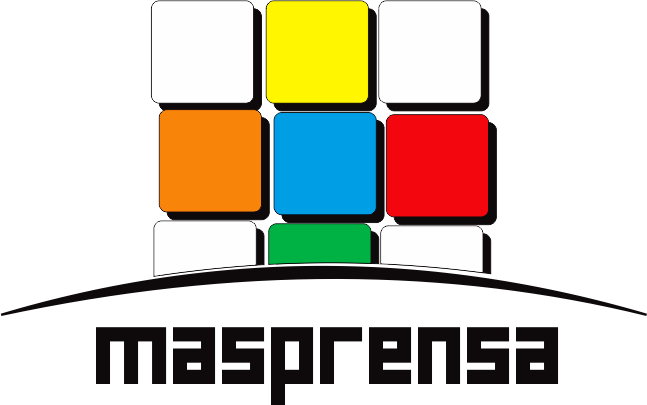Ein Versuch über Begehren, Gesetz und das Rätsel des Subjekts
Einleitung: Drei Namen, ein Unbehagen
Franz Kafka, Sigmund Freud und Jacques Lacan – drei Denker des Unbewussten, die auf unterschiedliche Weise das 20. Jahrhundert geprägt haben. Kafka als literarischer Seismograph einer Welt, in der das Subjekt sich schuldig fühlt, ohne zu wissen warum. Freud als Entdecker des Unbewussten, der Träume, Fehlleistungen und Symptome als verschlüsselte Botschaften des Begehrens las. Lacan als radikaler Neuerfinder Freuds, der das Unbewusste als „wie eine Sprache strukturiert“ verstand und das Subjekt in den Netzen des Symbolischen verortete.
Kafka hat Freud kaum rezipiert, Lacan wiederum hat Kafka intensiv gelesen. Dennoch scheint es, als habe Kafka jene Konflikte literarisch vorweggenommen, die Freud klinisch beschrieb und Lacan strukturell analysierte: das gespaltene Subjekt, das unerreichbare Gesetz, die tyrannische Vaterfigur, die Schuld ohne konkrete Tat, das Begehren, das sich im Umweg und im Scheitern manifestiert.
Dieser Artikel untersucht Kafka zwischen Freud und Lacan – nicht als bloßes Objekt psychoanalytischer Deutung, sondern als Autor, dessen Texte selbst eine Art psychoanalytische Theorie in literarischer Form darstellen.
I. Kafka und Freud: Schuld, Vater, Traum
1. Der Vater als Ur-Szene
Freuds Psychoanalyse beginnt mit dem Ödipuskomplex: dem Konflikt zwischen kindlichem Begehren, väterlichem Verbot und internalisierter Schuld. Kaum ein Text scheint diese Konstellation so drastisch zu inszenieren wie Kafkas „Das Urteil“. Der Sohn Georg Bendemann wird vom Vater mit einem einzigen performativen Akt zum Tode verurteilt – und vollzieht das Urteil selbst.
Freud hätte hier von einer Über-Ich-Dynamik gesprochen: Das väterliche Gesetz wird internalisiert und wirkt als strafende Instanz im Inneren des Subjekts. Die Gewalt des Vaters in Kafkas Werk ist nicht nur äußerlich, sondern strukturell: Sie wirkt als Stimme, als Urteil, als Gesetz, das nicht begründet werden muss.
Noch deutlicher wird diese Dynamik im „Brief an den Vater“. Kafka beschreibt den Vater als übermächtig, laut, körperlich dominant – als Instanz, vor der er sich klein, schwach, schuldig fühlt. Diese Schuld ist nicht an konkrete Taten gebunden. Sie ist atmosphärisch, existentiell.
Freuds These, dass Schuld oft unbewusst ist und aus verdrängten Konflikten stammt, findet hier eine literarische Entsprechung. Kafka scheint die Struktur des Über-Ichs zu verkörpern: eine Instanz, die straft, ohne transparent zu sein.
2. Die Schuld ohne Tat – „Der Prozeß“
In „Der Prozeß“ wird Josef K. verhaftet, ohne zu erfahren, welches Verbrechen er begangen hat. Die Parallele zu Freuds Theorie ist frappierend: Das Subjekt ist schuldig, weil es begehrt – nicht, weil es konkret gehandelt hat.
Freud beschrieb Schuld als Folge unbewusster Wünsche, insbesondere aggressiver und sexueller Impulse gegenüber den Eltern. Das Über-Ich bestraft diese Wünsche, auch wenn sie nie realisiert wurden. Kafka radikalisiert dieses Modell: Josef K. wird verurteilt, ohne dass überhaupt ein Wunsch oder ein Begehren expliziert würde. Die Schuld ist ontologisch.
Man könnte sagen: Kafka zeigt eine Welt, in der das Über-Ich totalisiert ist. Das Gesetz ist überall und nirgends. Es gibt keine Instanz, die es vollständig repräsentiert, aber jede Figur ist von ihm durchdrungen.
3. Traumlogik und Verdichtung
Freud analysierte Träume als Gebilde aus Verschiebung, Verdichtung und Symbolisierung. Kafkas Texte folgen oft einer traumartigen Logik. Räume verändern sich unmerklich, Hierarchien sind unklar, Zeitabläufe verzerren sich. Die Wirklichkeit wirkt real und zugleich surreal.
„Die Verwandlung“ beginnt mit einem typischen Traumereignis: Gregor Samsa erwacht als Käfer – und reagiert weniger entsetzt über seine Metamorphose als über die Verspätung zur Arbeit. Diese Verschiebung der affektiven Gewichtung entspricht Freuds Traummechanismen.
Gregor wird zum „Ungeziefer“ – eine radikale Selbstabwertung, die an das strenge Über-Ich erinnert. Seine Familie reagiert mit Abscheu und Aggression. Die Metamorphose kann als Manifestation eines unbewussten Selbstbildes gelesen werden: als Ausdruck verdrängter Wünsche nach Rückzug, Passivität oder Selbstauflösung.
Freud hätte hier von einer symptomatischen Bildung gesprochen – einer körperlichen Manifestation innerer Konflikte.
II. Kafka und Lacan: Das Gesetz, das Begehren, das Reale
Wenn Freud Kafka als klinischen Fall hätte lesen können, dann liest Lacan Kafka als Strukturmodell des Subjekts.
1. Das Gesetz als Signifikant
Für Lacan ist das Gesetz nicht primär moralisch, sondern symbolisch. Es ist das „Gesetz des Vaters“, das den Eintritt ins Symbolische markiert – die Ordnung der Sprache und der Differenz.
In „Vor dem Gesetz“ wartet ein Mann vom Lande sein Leben lang darauf, Einlass zu erhalten. Der Türhüter verweigert ihm den Zugang, obwohl die Tür „nur für ihn bestimmt“ ist. Am Ende stirbt der Mann, ohne das Gesetz betreten zu haben.
Lacan würde hier nicht nach einer konkreten Schuld suchen, sondern die Struktur analysieren: Das Gesetz ist immer vermittelt. Es ist nie unmittelbar zugänglich. Es existiert als Versprechen und als Aufschub.
Der Mann begehrt den Zugang zum Gesetz – doch gerade dieses Begehren hält ihn in der Warteposition. Das Gesetz ist der Signifikant des Begehrens: Es strukturiert das Subjekt, ohne sich jemals vollständig zu offenbaren.
2. Das Begehren des Anderen
Lacans berühmter Satz lautet: „Das Begehren ist das Begehren des Anderen.“ Das Subjekt begehrt nicht einfach Objekte, sondern begehrt, vom Anderen begehrt zu werden.
In „Der Prozeß“ versucht Josef K. ständig, den Sinn des Gerichts zu verstehen – oder zumindest die Haltung der Richter. Doch die Richter bleiben anonym. Das Gericht spricht nie direkt. Das Subjekt ist gefangen im Versuch, das Begehren des Anderen zu entziffern.
Diese Konstellation erzeugt paranoide Züge: Jede Geste könnte Bedeutung haben, jede Bemerkung Hinweis sein. Das Subjekt wird zum Interpreten eines unentzifferbaren Diskurses.
Lacan würde sagen: Josef K. ist im Netz der Signifikanten gefangen. Er sucht nach einem letzten Sinn, nach einem Master-Signifikanten, der alles erklärt – doch dieser existiert nicht.
3. Das Reale und die Unmöglichkeit
Ein zentrales Konzept Lacans ist das Reale: das, was sich der Symbolisierung entzieht. In Kafkas Texten gibt es oft einen Kern des Unaussprechlichen – ein Zentrum, das nicht erklärt wird.
Warum wird Josef K. verurteilt? Warum verwandelt sich Gregor? Warum ist das Schloss unerreichbar?
Diese Fragen bleiben offen. Das Reale zeigt sich als Lücke im Sinngefüge. Kafka verweigert psychologische Motivierung. Seine Texte kreisen um ein Loch im Symbolischen.
Gerade diese Leerstelle macht sie so modern. Das Subjekt hat keinen stabilen Kern. Es ist Effekt von Sprache und Gesetz – und zugleich von einem Mangel durchzogen.
III. Zwischen Neurose und Struktur: Kafka als Paradigma
1. Kafka als neurotisches Subjekt?
Freud hätte Kafka vermutlich als Zwangsneurotiker diagnostiziert. Die permanente Selbstbeobachtung, die Schuldgefühle, die Ambivalenz gegenüber Autorität – all dies passt in das Bild einer neurotischen Struktur.
Doch Lacan verschiebt die Perspektive: Nicht Kafka ist neurotisch, sondern die Struktur des Subjekts selbst ist gespalten. Kafka zeigt diese Spaltung exemplarisch.
Das Subjekt ist bei ihm immer schon im Anderen verstrickt. Es ist adressiert, angeklagt, beobachtet. Autonomie ist Illusion.
2. Sprache als Gefängnis
Lacan betont, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert ist. Kafka inszeniert genau diese Sprachhaftigkeit der Macht.
Die Bürokratie in „Der Prozeß“ oder „Das Schloß“ operiert mit Akten, Formularen, Titeln, Rängen. Sprache ist nicht Kommunikationsmittel, sondern Machtinstrument.
Das Subjekt versucht, durch Sprache Zugang zu gewinnen – doch Sprache produziert nur weitere Verschiebungen. Jede Antwort erzeugt neue Fragen.
Kafka zeigt die Unmöglichkeit eines letzten Signifikats. Die Bedeutung gleitet. Das Gesetz ist Text – und dieser Text ist unabschließbar.
3. Die Figur des Schreibens
Kafka war selbst Jurist und Versicherungsangestellter – also Teil jener Bürokratie, die er literarisch seziert. Das Schreiben wird bei ihm zur Gegenbewegung: ein Versuch, das Gesetz zu unterlaufen, indem man es ästhetisch reproduziert.
Freud verstand das Schreiben als Sublimierung – als Umwandlung verdrängter Impulse in kulturelle Produktion. Lacan hingegen sieht im Schreiben eine Einschreibung in die Ordnung der Signifikanten.
Kafka schreibt nicht, um sich zu befreien. Er schreibt, um die Struktur sichtbar zu machen. Seine Texte sind Versuchsanordnungen des Subjekts im Feld des Gesetzes.
IV. Differenzen: Wo Freud nicht reicht, wo Lacan weitergeht
Freuds Modell ist konflikttheoretisch: Es geht um Trieb, Verdrängung, Symptom. Kafka jedoch zeigt weniger verdrängte Sexualität als eine strukturelle Ohnmacht gegenüber anonymen Instanzen.
Hier ist Lacan präziser: Das Gesetz ist nicht nur Vaterfigur, sondern symbolische Ordnung. Die Schuld ist nicht nur neurotisch, sondern konstitutiv.
Gleichzeitig bleibt Lacans Theorie abstrakt. Kafka hingegen gibt der Struktur eine existenzielle Dichte. Er zeigt, wie sich das Symbolische anfühlt: als Angst, als Scham, als Fremdheit im eigenen Leben.
Freud erklärt, Lacan strukturiert – Kafka erfahrbar macht.
V. Schluss: Kafka als literarischer Psychoanalytiker
Kafka steht zwischen Freud und Lacan, weil er beide vorwegnimmt und übersteigt.
Er zeigt:
- das Subjekt als schuldig ohne Tat (Freud),
- das Gesetz als unerreichbaren Signifikanten (Lacan),
- das Begehren als endlosen Aufschub,
- die Sprache als Machtstruktur,
- das Reale als Lücke im Sinn.
Seine Texte sind keine Fallgeschichten, sondern Strukturanalysen in erzählerischer Form. Sie zeigen nicht nur, dass das Unbewusste existiert – sie zeigen, wie es sich anfühlt, darin zu leben.
Vielleicht ist Kafka deshalb so verstörend aktuell: In einer Welt aus Algorithmen, Formularen und anonymen Instanzen wirkt sein Universum weniger surreal als prophetisch. Das Subjekt wartet weiterhin „vor dem Gesetz“, das ihm versprochen wurde, aber nie zugänglich ist.
Freud hat das Unbewusste entdeckt.
Lacan hat es sprachlich strukturiert.
Kafka hat es literarisch bewohnt.
Und vielleicht liegt gerade darin seine Größe: Er liefert keine Theorie – sondern eine Erfahrung des Getrenntseins, des Begehrens und des unerreichbaren Gesetzes, die Theorie erst notwendig macht.